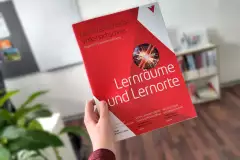Weltkonferenz zur Erwachsenenbildung: Follow-Up nahm Europa unter die Lupe

Erwachsenenbildung ist in breiteren politischen Strategien wenig verankert
Im Rahmen der Konferenz gaben mehrere Referent*innen einen Überblick über die Situation der Erwachsenenbildung in der EU. So zeigte Raffaela Khirer vom Europäischen Verband der Erwachsenenbildung und von der Plattform für Lebenslanges Lernen auf, dass es auf EU-Ebene einen soliden politischen Rahmen für Erwachsenenbildung und Lebenslanges Lernen (LLL) gibt. Anders sehe es aus, wenn man Politiken betrachte, die nicht primär Erwachsenenbildung und LLL zum Gegenstand haben, in denen diese Themen aber durchaus eine bedeutende Rolle spielen könnten. Es fielen Stichworte wie Demografischer Wandel, grüner Wandel und Krise der Demokratie. Die Erwachsenenbildung werde in diesen Strategien oft nicht berücksichtigt. Dies sei "ein alarmierendes Zeichen dafür, dass auf politischer Ebene mehr getan werden muss", so Khirer.
Weiterbildungsteilnahme erhöht sich kaum und Finanzierung stagniert
Danach bezog sich Khirer auf die konkrete Umsetzung der Ziele aus europäischen und internationalen Politiken und Aktionsrahmen. Sie griff das Ziel des MFA und anderer europäischer Politiken auf, die Teilnahme an nicht-formaler und formaler Bildung zu erhöhen. Ein Blick auf die Daten belege, dass der Anstieg der Teilnehmer*innenzahlen gering sei.
Ein ähnliches Bild zeige sich bei der Finanzierung von Weiterbildung. Ein erklärtes Ziel des MFA ist es, die öffentliche Finanzierung zu erhöhen und Rückschritte zu verhindern. Laut Khirer stagniert in zahlreichen Ländern die Finanzierung seit vielen Jahren, in einigen Ländern wird sogar von Rückgängen berichtet (siehe auch Länderberichte des EAEA). Sie unterstrich die Komplexität der Finanzierungssysteme von Erwachsenenbildung, deren Schwerpunkt auf privaten Finanzmitteln liege und ein Hindernis für Menschen mit geringeren finanziellen Ressourcen darstelle: "Eine große Zahl von Lernenden ist damit schon von der Teilnahme an Weiterbildung ausgeschlossen", so Khirer.
Individuelle Lernkonten und Weiterbildungspfade sollen Ziele des Aktionsrahmens unterstützen
Julie Fionda von der Europäischen Kommission widmete sich dem Thema im Kontext des EU-Jahres der Kompetenzen und betonte die Herausforderung des Fachkräftemangels in Europa. Fionda erwähnte, dass 38 Berufe 2022 europaweit als Mangel eingestuft wurden (siehe z.B. EURES-Bericht 2022 - PDF). Außerdem gab sie an, dass 74% der Klein- und Mittelbetriebe (KMU) erwarten, 2023 mit Fachkräftemangel konfrontiert sein zu werden (sie etwa Eurobarometer-Bericht 2023 - PDF). Sie fragte danach, was man dagegen auf EU-Ebene tun könne und verwies zum Beispiel auf die "Europäische Säule sozialer Rechte", die u.a. dafür stehe, dass jede*r das Recht auf qualitativ hochwertige und inklusive Bildung haben solle. Fionda hob zwei Aktionen besonders hervor, die zu den Zielen des MFA beitragen sollen: Individuelle Lernkonten und Weiterbildungspfade ("Upskilling Pathways").
Die Stimme der Lernenden hervorheben und politische Partizipation unterstützen
Einen weiteren Schwerpunkt legte die Konferenz auf die Rolle von zivilgesellschaftlichen Organisationen bei der Umsetzung des MFA. Dearbháil Lawless von der irischen Organisation für Erwachsenenbildung AONTAS, befasste sich mit der Frage, wie zivilgesellschaftliche Organisationen den Wandel vorantreiben können und stellte drei zentrale Aspekte in den Vordergund:
- Den Aufbau von Verbindungen zum Austausch von Wissen und Praxis;
- Das Einwirken auf Politik und das Fördern konstruktiver Beziehungen;
- Einigung, Wirkung und Verantwortung.
In diesem Zusammenhang betonte Lawless, dass es darum gehe, bereits existierende Netzwerke und Plattformen, wie etwa EAEA, EBSN, ICAE, EPALE und Erasmus+-Netzwerke zu nutzen. Darüber hinaus gelte es, nach frei zugänglichen Möglichkeiten für die Beteiligung an politischen Prozessen zu suchen. Dabei könne man Geschichten und Stimmen der Lernenden sichtbar machen und diese insbesondere dabei unterstützen, sich selbst an politischen Konsultationen beteiligen zu können.
Die Perspektive wechseln: Weniger Individualismus und mehr Gesellschaft
Tatjana Babrauskienė (Litauische Gewerkschaft für Bildung und Wissenschaft und Mitglied des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses) machte in ihrem Vortrag u.a. deutlich, dass Zusammenarbeit der Schlüssel zum transformativen inklusiven Aufschwung sei. Als Stichworte nannte sie individuelle Lernkonten, Mikro-Credentials und Peer-Learning.
Weiters sei es wichtig, eine Kultur der Partizipation zu fördern. "In Zeiten der Krise fühlen sich die Menschen als Individualist*innen, sie kümmern sich um sich selbst und darum, wie sie überleben können", so Babrauskienė. Sie ergänzte, dass die Menschen aufhören würden, über die Gesellschaft als Ganzes nachzudenken. Deshalb müssen wir darüber nachdenken, wie wir die Perspektive ein wenig ändern können, so Babrauskienė. Kollektives Denken und das Engagement für die gesamte Gesellschaft seien wichtig. "Aber wer sind diejenigen, die das tun sollen?", fragte Babrauskienė. "Hier müssen wir die Rolle der Zivilgesellschaft, der Nichtregierungsorganisationen, der Sozialpartner stärken."
Die Konferenz wurde vom UNESCO-Institut für Lebenslanges Lernen (UIL) in Zusammenarbeit mit der Plattform für Lebenslanges Lernen (LLLP) und dem Europäischen Verband für Erwachsenenbildung (EAEA) organisiert.
Nachrichten-Serie: Erwachsenenbildung im Europäischen Jahr der Kompetenzen
Gesellschaftlichen Herausforderungen mit Bildung begegnen: Gerade wenn es um den akuten Arbeitskräftemangel oder den zu bewältigenden grünen und digitalen Wandel geht, sieht die EU Weiterbildung und lebenslanges Lernen als wichtiges Instrument für die Zukunft Europas. Die Europäische Kommission lanciert daher 2023 das "Europäische Jahr der Kompetenzen". Wir begleiten dieses Jahr mit der Nachrichten-Serie "Erwachsenenbildung im Europäischen Jahr der Kompetenzen". Die Serie bündelt Beiträge, die sich dem EU-Jahr und aktuellen Fragen rund um Kompetenzen für die Zukunft widmen.
Verwandte Artikel
![Person setzt einen Würfel mit einem Bild mit Pfeil und Bogen auf einen Würfelturmmit weiteren Bildern]()
Bildungsinteressierte für ihre Kompetenzen sensibilisieren
Auf erwachsenenbildung.at finden Ratsuchende Tipps und Ideen, um sich mit eigenen Stärken und Interessen auseinanderzusetzen und passende Beratungsangebote zu finden.![Weltkugel in zwei Händen. Die Hände tragen Arbeitshandschuhe.]()
Das Jahr 2050: Zu wenig Green Skills in einem überholten Europa?
Wissenschaftler*innen skizzieren vier mögliche Zukunftsszenarien für Europa und leiten daraus Vorschläge ab, die auch die Erwachsenenbildung betreffen.![Hand hält ÖVH-Ausgabe]()
Die aktuelle ÖVH-Ausgabe widmet sich Lernräumen und Lernorten
Was macht einen guten Lernraum aus? „Safe Spaces“ und die Ausstattung von Kursräumen sind mögliche Antworten darauf, die die Zeitschrift „Die Österreichische Volkshochschule“ (ÖVH) näher ausführt.![Grafik von drei Personen am Ende unterschiedlicher Linien die alle zu einer EU-Flagge führen]()
Passende EU-Förderprogramme für die eigene Bildungseinrichtung finden
Das Online-Tool PATH2EU4AE hilft herauszufinden, ob Organisationen die Kriterien für EU-Programme erfüllen, beinhaltet Tipps von Expert*innen und empfiehlt geeignete Förderprogramme.![Drei Personen sitzen jeweils vor einem Notebook.]()
Jetzt bewerben: European Digital Skills Awards 2024
Bis 2. April 2024 können sich Organisationen mit einem Projekt zur Förderung digitaler Kompetenzen für die Auszeichnung der Digital Skills and Jobs Plattform der Europäischen Kommission bewerben.![Zeichnung: Wahlurne mit EU-Fahne, darüber ein Zettel mit einem „X“.]()
Überblick zu Bildungsveranstaltungen im Rahmen der Europa-Wahlen
Die Plattform schule.at bietet einen Überblick über Veranstaltungen zum Thema „EU-Wahlen“ für Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene. Am Programm stehen u.a. E-Lectures, Diskussionen, Podcasts und Live-Dokumentationen.