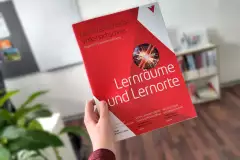Schweizer Weiterbildungsgesetz: Wie hat es sich ausgewirkt?

In diesem Zusammenhang ist ein Blick über die Grenzen interessant – zum Beispiel in die Schweiz. 2017 trat dort das bereits 2014 verabschiedete Schweizer Weiterbildungsgesetz (WeBiG) in Kraft. Was hat das neue Gesetz inzwischen bewirkt? Mit dieser Frage setzen sich Irina Sgier, André Schläfli und Bernhard Gräminger in dem vorigen Oktober erschienenen Länderporträt "Weiterbildung in der Schweiz" auseinander. Die Autor*innen sind oder waren in der Leitung des Schweizer Verbands für Weiterbildung (SVEB) tätig und kennen die Situation genau.
Gesetzesentwicklung bis 2014: Eine mehrjährige Herausforderung mit vielen Debatten
Das Schweizer Parlament hat im Juni 2014 das neue Weiterbildungsgesetz (WeBiG) verabschiedet, das 2017 in Kraft trat. Die Entwicklung dauerte mehrere Jahre und erforderte viele Debatten. Denn das Gesetz regelt ein heterogenes, unübersichtliches und dynamisches Feld, das zahlreiche Überschneidungen mit anderen gesellschaftlichen Bereichen aufweist. So existieren in der Schweiz insgesamt 80 Spezialgesetze, die auch Bestimmungen zur Weiterbildung enthalten und folglich bei der Entwicklung des WeBiG berücksichtigt werden mussten. Das WeBiG ist daher kein weiteres Spezialgesetz, sondern ein Rahmengesetz, das allgemeine Kriterien und Grundsätze definiert, welche für sämtliche die Weiterbildung betreffenden Bestimmungen in den Spezialgesetzen gelten.
Fünf Grundsätze und erstmals Förderung von Grundkompetenzen Erwachsener gesetzlich verankert
Das Gesetz bildet den Status quo der Schweizer Weiterbildung ab. Es regelt Zuständigkeiten, erklärt Schnittstellen und ordnet Weiterbildung in das Bildungssystem ein. Es gewichtet stark die Eigenverantwortung des*r Einzelnen für seine*ihre eigene Weiterbildung und ist damit als politisch sehr liberal zu bezeichnen, so die Autor*innen des Länderporträts.
Kernstück sind fünf Grundsätze, die als Rahmen für den gesamten non-formalen Weiterbildungsbereich gelten:
- Verantwortung (Art. 5)
- Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung (Art. 6)
- Anrechnung von Bildungsleistungen an die formale Bildung (Art. 7)
- Verbesserung der Chancengleichheit (Art. 8)
- Wettbewerb (Art. 9)
Mit der Verabschiedung des WeBiG 2014 wurde in der Schweiz erstmals auch die Förderung von Grundkompetenzen von Erwachsenen gesetzlich verankert. In Kraft trat das Gesetz erst drei Jahre später im Jahr 2017. Bis dahin entwickelte die Regierung Bestimmungen, die regeln, wie das Gesetz und damit die Förderung von Grundkompetenzen Erwachsener umgesetzt werden kann.
Dachverbände der Weiterbildung erhalten mehr Förderung
Positive Auswirkungen hatte das WeBiG auch auf die Schweizer Dachverbände der Weiterbildung. Ähnlich der KEBÖ-Leistungsvereinbarungen zwischen Bund und KEBÖ in Österreich regelt das WeBiG für die Schweiz erstmals Leistungsvereinbarungen mit den Dachverbänden, wodurch diese für vier Jahre 16 Mio. CHF (15 Mio. Euro) Förderung erhielten. Dieser Betrag ermöglichte sieben nationalen Weiterbildungseinrichtungen, deutlich mehr übergeordnete Leistungen für den Weiterbildungsbereich zu erbringen, als dies vor der Einführung des Gesetzes möglich war.
Wenig Wirkung wegen geringer Regelungen kritisiert
"Regierung und Parlament waren nicht bereit, ein über diese minimale Regelung hinausgehendes Gesetz zu schaffen, das zukunftsweisende, innovative Entwicklungen hätte anregen und unterstützen können", kritisieren die Autor*innen des Länderporträts. Etwa wurden die fünf Grundsätze in den Ausführungsbestimmungen nicht geregelt, kritisierte der SVEB schon in seinem Jahresbericht 2016. Zumindest die Grundsätze "Qualitätssicherung und Qualitätsentwicklung" (Art. 6) und "Anrechnung von Bildungsleistungen an die formale Bildung" (Art. 7) wären für die Entwicklung des Schweizer Weiterbildungssystems essenziell, müssten nun aber auf anderem Weg umgesetzt werden, so der SVEB weiter.
Viele Akteur*innen der Weiterbildung würden bedauern, dass das WeBiG nur ein minimales Gesetz geworden sei. Dadurch sei vor allem das Ziel, Voraussetzungen zu schaffen, um allen Erwachsenen die Teilnahme an Weiterbildung zu ermöglichen, nur ungenügend eingelöst worden.
Dynamik bei Förderung der Grundkompetenzen Erwachsener
Die größte Dynamik habe das WeBiG bisher in der Förderung der Grundkompetenzen Erwachsener ausgelöst, so die Autor*innen. Hier hatten Bund und Kantone Weiterbildungsanbieter und Sozialpartner einbezogen, um gemeinsam ein Grundsatzpapier auszuarbeiten, das die gemeinsamen Ziele im Bereich Grundkompetenzen definiert. Auf dieser Grundlage haben 21 von 26 Kantonen von 2017 bis 2020 Förderstrukturen im Bereich Grundkompetenzen aufgebaut, respektive verbessert und knapp 15 Mio CHF (14 Mio. Euro) investiert. Zum Vergleich: In Österreich regeln die Bund-Länder-Vereinbarungen nach §15a Förderungen von Basisbildung und der Nachholung des Pflichtschulabschlusses in der Initiative Erwachsenenbildung (IEB). Das Budgetvolumen der IEB umfasste zwischen 2018-2021 ein Vielfaches, 111,5 Mio, so die IEB im Rahmen einer Tagung im Juni 2022.
- Länderporträt Weiterbildung in der Schweiz
- WeBiG: Bundesgesetz über die Weiterbildung (Schweiz)
- SVEB Jahresbericht 2016 (PDF)
- Was das neue Regierungsprogramm für die Erwachsenenbildung bringt (Nachricht vom 08.01.2020)
- 50 Jahre Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs (KEBÖ) (Nachricht vom 05.10.2022)
- Erwachsenenbildungsförderungsgesetz in Österreich
- Initiative Erwachsenenbildung: Annual Conference of the ESBN in Vienna 2022 June (PDF)
Verwandte Artikel
![Hand hält ÖVH-Ausgabe]()
Die aktuelle ÖVH-Ausgabe widmet sich Lernräumen und Lernorten
Was macht einen guten Lernraum aus? „Safe Spaces“ und die Ausstattung von Kursräumen sind mögliche Antworten darauf, die die Zeitschrift „Die Österreichische Volkshochschule“ (ÖVH) näher ausführt.![Zeichnung: Wahlurne mit EU-Fahne, darüber ein Zettel mit einem „X“.]()
Überblick zu Bildungsveranstaltungen im Rahmen der Europa-Wahlen
Die Plattform schule.at bietet einen Überblick über Veranstaltungen zum Thema „EU-Wahlen“ für Kinder und Jugendliche, aber auch für Erwachsene. Am Programm stehen u.a. E-Lectures, Diskussionen, Podcasts und Live-Dokumentationen.![Hände halten ein Smartphone, darüber sind Icons, die einen Gesetzesentschluss symbolisieren.]()
Was bedeutet das europäische KI-Gesetz für die Bildung?
Der Einsatz von KI-Systemen in der EU soll reguliert und damit sicher gestaltet werden. Was beinhaltet der Gesetzestext und wie wirkt sich das auf den Bildungsbereich aus?![Vier Personen fügen vier große Puzzle-Teile zusammen.]()
Soft Skills gewinnen in europäischen Unternehmen an Bedeutung
Die Eurobarometer-Umfrage zum Arbeitskräftemangel in der EU zeigt, welche Herausforderungen und Lösungen die Unternehmen sehen und welche Kompetenzen gefragt sind.![Eine Person sitzt vor einem Laptop.]()
Weiterbildung hat Einfluss auf digitale Fertigkeiten
Die Studie „Digital Skills Austria 2023“ kam zum Ergebnis, dass sich Weiterbildungsangebote zu digitalen Technologien positiv auf die eigenen Fertigkeiten auswirken.![Blatt Papier mit Balkendiagramm.]()
Weiterbildung gilt weiterhin als wichtig, an der Umsetzung hapert es
Der Weiterbildungsbarometer des WIFI hat die Sicht von Unternehmen und Beschäftigten auf die berufliche Weiterbildung erhoben.